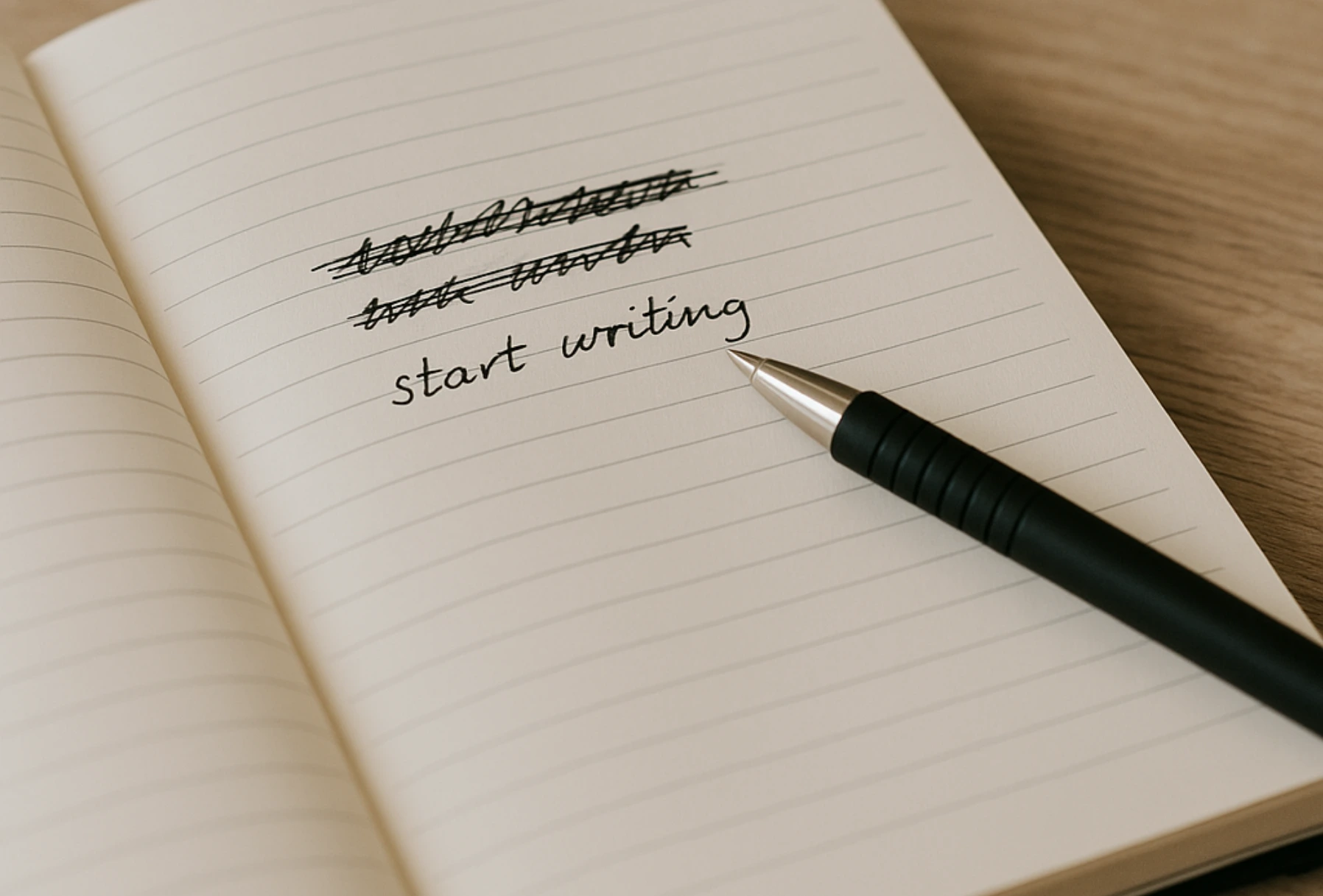Kontingenter Selbstwert
Wenn wir anderen mehr glauben, als uns selbst.

Szene aus einer Coaching-Sitzung mit Sarah (Name geändert):
Sarah befindet sich mitten in einer Bewerbungsphase. Für eine Stelle, die ihrer Meinung nach gut zu ihr gepasst hätte, erhält sie eine standardisierte Absage. Sie erzählt mir im Coaching, dass sie das komplett aus der Bahn geworfen hat. Sie beginnt, ihre Fähigkeiten infrage zu stellen, fühlt sich wertlos und sagt: „Ganz offensichtlich kann ich niemanden von mir überzeugen.“
Einen Tag später ruft dieselbe Firma an: Man habe ihre Bewerbung mit Interesse gelesen, sei jedoch unsicher, ob ihre spezifische Berufserfahrung auf die ausgeschriebene Position passe – gleichzeitig wolle man mit ihr über eine andere, möglicherweise passendere Rolle sprechen. In Sekunden kippt Sarahs Gefühlslage: Alle Zweifel, die eben noch laut waren, sind verstummt. Stattdessen: Erleichterung, Zuversicht, Freude.
Im Coaching beschreibt sie ihre Frustration darüber, dass ein so kleines Signal von außen – ein Feedback oder auch dessen Ausbleiben – ihre Selbstwahrnehmung so stark beeinflusst. Sie sagt: „Ich fühle mich wie ein Fähnchen im Wind. Ich möchte, dass Feedbacks nicht mehr diese Macht über mich haben.“
Wenn das Außen lauter ist als das Innen
Mit diesem Muster ist Sarah nicht allein.
Da ist Silke, die erst dann überzeugt ist, dass ihr Event erfolgreich war, wenn jemand sie im Nachgang für „die tolle Organisation“ lobt.
Oder Lisa, die erst glauben kann, dass ihr Vortrag Wirkung gezeigt hat, wenn Teilnehmende sie anschließend dafür wertschätzen.
Und Andrea, die sich selbst erst erlaubt, erschöpft zu sein, als ihre Therapeutin sagt: „Kein Wunder, dass Sie müde sind – das, was Sie gerade stemmen, ist einfach zu viel.“ Was all diese Situationen verbindet:
Die innere Erlaubnis, etwas zu fühlen oder als wahr anzunehmen, entsteht erst, wenn das Außen es spiegelt. Wir geben anderen damit – oft unbewusst – mehr Deutungshoheit über unser Erleben als uns selbst.
Woher kommt dieses Muster?
Eine mögliche Erklärung liegt in unseren frühen Lernerfahrungen. Viele von uns haben schon als Kinder gelernt, dass Sicherheit von außen kommt. Wenn wir uns so verhalten haben, wie es von uns erwartet wurde, gab es Anerkennung – ein Lächeln, ein Lob, Nähe. Wenn nicht, folgte Enttäuschung, Rückzug oder Kritik.
So entsteht oft früh das unbewusste Muster: „Ich bin richtig, wenn andere mich richtig finden.“
Diese Dynamik setzt sich später in vielen Lebensbereichen fort – in Schule, Freundeskreisen, Medien und Arbeitswelt. Überall dort, wo Leistung sichtbar gemacht, bewertet oder verglichen wird.
Doch so verständlich diese Prägung ist – sie erklärt nur den Ursprung, nicht die Wirkung. Denn irgendwann wird das Außen zum inneren Maßstab. Und damit schwindet die Fähigkeit, die eigene Wahrnehmung als gültig anzuerkennen.
Definition: Selbstwertkontingenz
Unter Selbstwertkontingenz wird die Abhängigkeit des Selbstwerts von dem Erreichen interner und externer Standards in selbstwertrelevanten Bereichen verstanden (siehe Dorsch).
Kontingenter Selbstwert – wenn das Ich am Außen hängt
In der Psychologie spricht man in diesem Zusammenhang vom kontingenten Selbstwert. Er beschreibt, dass unser Selbstwertgefühl nicht stabil in uns verankert ist, sondern an äußere Bedingungen geknüpft bleibt – an Erfolge, Anerkennung oder Zustimmung.
Bleibt diese aus, gerät das Selbstwertgefühl ins Wanken.
So sagt Lisa: „Ich brauche das Feedback, dass mein Vortrag wertvoll war, um glauben zu dürfen, dass er es wirklich war.“
Ihr inneres Echo lautet nicht: Ich bin genug.
Sondern: War das genug?
Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern Ausdruck eines tief verankerten Mechanismus. Er führt jedoch dazu, dass unser Selbstbild fragiler wird, je stärker wir auf Bestätigung angewiesen sind.
Wie eine Raupe Nimmersatt sucht der kontingente Selbstwert nach der nächsten Portion Anerkennung. Doch das Sättigungsgefühl bleibt aus.
Und manchmal entsteht ein paradoxer Nebeneffekt: Selbst positives Feedback kann dann nicht mehr geglaubt werden. Wenn die innere Überzeugung „Ich bin nicht genug“ fest verankert ist, wird jedes Lob durch einen inneren Filter relativiert: „Das meint er oder sie sicher nicht so. Da muss ein Haken sein.“
Wenn die eigene Stimme leiser wird
Ein instabiler Selbstwert, der stark vom Außen abhängt, ist ein idealer Nährboden für Stress und mentale Erschöpfung.
Menschen, die erst durch andere die Erlaubnis erhalten, sich wertvoll oder erschöpft fühlen zu dürfen, übersehen häufig ihre eigenen Grenzen.
Sie hören das Signal des Körpers oder der Psyche – aber glauben ihm nicht, bis jemand anderes es bestätigt.
Das Risiko: ein dauerhaftes Übergehen der eigenen Bedürfnisse, das auf Dauer in Richtung Burnout führen kann.
Nicht, weil diese Menschen weniger resilient wären, sondern weil ihre innere Stimme übertönt wird von der Frage: „Ist das gerade okay?“
Selbstvertrauen als leiser Prozess
Was wir über viele Jahre lernen, lässt sich nicht über Nacht verändern. Und es braucht auch keinen radikalen Bruch.
Die Orientierung am Außen ist nicht per se schlecht – sie kann auch Empathie, soziale Kompetenz und Sensibilität fördern. Menschen, die fein auf ihr Umfeld reagieren, spüren oft schneller unausgesprochene Spannungen oder Bedürfnisse anderer. Das sind wertvolle Fähigkeiten.
Es geht also nicht darum, das Außen völlig auszublenden.
Sondern darum, das Gleichgewicht wiederzufinden:
das Außen als Resonanz, nicht als Bewertung zu verstehen.
Drei Impulse für mehr innere Selbstbestätigung
- 1. Beobachte den Moment der Verschiebung. Wann ändert sich deine Selbstwahrnehmung – unmittelbar nachdem jemand anderes etwas sagt oder nicht sagt?
Allein das Wahrnehmen dieser Verschiebung ist der erste Schritt, wieder bei dir selbst anzukommen. - 2. Übe Selbstvalidierung. Wenn du merkst, dass du auf ein Feedback wartest: Sag dir innerlich, was du selbst beobachtest. Zum Beispiel: „Ich habe mich gut vorbereitet.“, „Ich war präsent.“
Es geht nicht um Überzeugungsarbeit, sondern um den bewussten Akt, deiner Wahrnehmung Gewicht zu geben. - 3. Lass Lob stehen. Wenn dich jemand für etwas lobt, halte einen Moment inne – und widersprich nicht automatisch („Ach, das war doch nichts“). Nimm es an, ohne es zu relativieren. Das ist kein Narzissmus, sondern eine Übung in Selbstannahme.
Als Abschlussgedanke:
Selbstvertrauen ist kein lauter Zustand.
Es ist ein leiser Satz, den wir uns irgendwann wieder selbst sagen können: „Ich weiß, dass das gut war.“
Und ihn uns auch glauben.